Install Steam
login
|
language
简体中文 (Simplified Chinese)
繁體中文 (Traditional Chinese)
日本語 (Japanese)
한국어 (Korean)
ไทย (Thai)
Български (Bulgarian)
Čeština (Czech)
Dansk (Danish)
Deutsch (German)
Español - España (Spanish - Spain)
Español - Latinoamérica (Spanish - Latin America)
Ελληνικά (Greek)
Français (French)
Italiano (Italian)
Bahasa Indonesia (Indonesian)
Magyar (Hungarian)
Nederlands (Dutch)
Norsk (Norwegian)
Polski (Polish)
Português (Portuguese - Portugal)
Português - Brasil (Portuguese - Brazil)
Română (Romanian)
Русский (Russian)
Suomi (Finnish)
Svenska (Swedish)
Türkçe (Turkish)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Українська (Ukrainian)
Report a translation problem






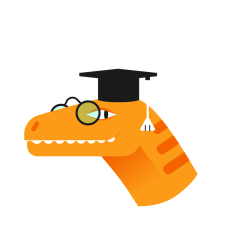
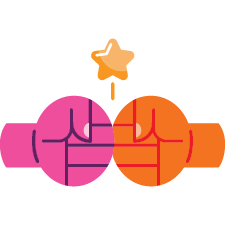

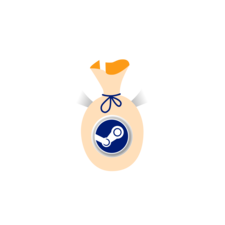











































































































In der Realität liegt die bei 327,5. Bei mir im Spiel schmilz das Zeug aber auch nicht sofort weg.
Eine Frage zwecks SPOM: Wie produzierst du den Strom? Jeweils ein Wasserstoffgenerator, Smart Batterie und kleiner Transformator?
Da hab ich aber einen kleinen Tipp für dich (wenn es nicht schon zu spät ist :)), versuchs mal mit dem Spaced Out DLC. Der überarbeitet komplett den Weltraum und macht auch die Meteoritenschwärme weg. Ist in dieser Hinsicht meiner Meinung nach viel besser. Der ganze Weltraumkrempel in Vanilla hat mir nämlich auch nicht so viel Freude bereit. Fand ich einfach nur Mühsam und nicht so Spaßig.
Wie wärs denn damit:
* https://www.youtube.com/watch?v=7Q7K2C1Zti0 (englisch)
* https://www.youtube.com/watch?v=ckjGK-QqnuU (deutsch)
in dem Umfeld sollte deine Frage eigentlich beantwortet werden.
ich hoffe ich konnte dir damit helfen!
Und Seiten für Oni gibt es eigentlich reichlich, z.B. auf reddit einfach mal nach deinem Problem stöbern, https://www.reddit.com/r/Oxygennotincluded/ , da finde ich eiegntlich immer was.
Die Frage ist ob du Bunkertüren baust und die zu machst wenn ein Meteroitenschwarm kommt. Anschließend das tuntergekommene Regolith automatisch abbauen.
Des Weiteren gibt es natürlich ein Haufen Videos zu diesen Themen. Ich selbst folge eigentlich immer noch recht regelmäßig John Francis und einem deutschen Youtuber mit namen Chrillo-gaming. In dem Material muss man halt stöbern und sich das geeignete raussuchen.
Ich schau aber mal ob ich was finde, dauert aber noch 1-2 Tage :)
Kennen Sie vielleicht einen Chat oder Tippseite in Deutsch für ONI. Ich komme jetzt ab Tag 400 immer mehr an meine Grenzen. Insbesondere die Hitze im Weltall bzw. von dem Zeug was da runterkommt, bekomme ich nicht in den Griff. Habe mal probeweise mein überschüssiges CO2 nach oben gepumpt, um alles auf ca. 75 Grad runter zu bekommen. Problem ist, dass dann das Vakuum aufgehoben wird und die Hitze sich rasend schnell ausbreitet und mein Transportsystem überhitzt. Ich sei denn, ich bau alles aus Stahl, aber das kann es ja nicht sein.
Scheint mir aber ein Bug zu sein. Im Zusammenhang mit dem DLC kommt es sowieso vermehrt zu Bugs.